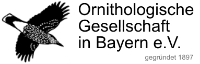Ein Projekt von:


.
Um mehr über die Verbreitung unserer heimischen Vögel in der Winterzeit zu erfahren, haben wir zusammen mit dem Landesbund für Vogel- und Naturschutz ein neues Mitmachprojekt für Vogelbegeisterte geschaffen. Wer mitmachen möchte kann sich ab sofort hier eine Fläche auf unserer Karte reservieren.
.
Wozu Vögel im Winter kartieren?
Abgesehen von bestimmten Artengruppen oder einzelnen Arten wie Wasservögel oder Kormorane wissen wir über die Verbreitung von Vögeln im Winter nur recht wenig. Die Stunde der Wintervögel beschränkt sich auf den Siedlungsbereich und Einträge von Winterbeobachtungen auf ornitho.de sind meist zufällig und „Allerweltsarten“ eher unterrepräsentiert.
Eine systematische Erfassung von Vögeln im Winter wäre aber gerade im Lichte der derzeitigen Diskussion um die Auswirkungen des Klima- und Landschaftswandels äußerst wichtig. Denn es gibt bereits eine Reihe von Hinweisen, dass sich die Winterverbreitung von Arten in den letzten Jahrzehnten verändert hat, vornehmlich bedingt durch die zu nehmend milderen Winter.
Auch für einen umfassenden Artenschutz benötigen wir mehr Informationen. So ist der Winter für ganzjährig anwesende Arten oftmals ein ökologischer „Flaschenhals“, der in ganz erheblichem Maß die Bestandsentwicklung bestimmt. Soll der Artenschutz auch solche Winteraspekte berücksichtigen, muss zunächst einmal überhaupt bekannt sein, wo welche Art im Winter vorkommt.
Dies wollen wir mit dem Wintervogel-Atlas Bayern erreichen.
.
Wie funktioniert die Kartierung?
Um eine Mitarbeit zu erleichtern, soll auf der Grundlage der Quadranten (TK-Viertel) der topografischen Karten (TK) 1:25.000 von Bayern lediglich erfasst werden, ob eine Art im Raster vorkommt oder nicht (sogenannte Präsenz/Absenz-Erfassung). Es finden dazu eine Begehung zwischen dem 15. November und 31. Dezember (Frühwinter) und eine weitere zwischen 1. Januar und 15. Februar statt (Hochwinter). Zwischen beiden Zeiträumen muss mindestens ein Abstand von zwei Wochen sein.
Bevorzugt sollen die Begehungen im Dezember und Januar erfolgen, um sehr späte Wegzügler und sehr frühe Rückkehrer nicht zu erfassen. Die Zähltermine sind nicht vorgegeben, da es gerade im Winter wichtig ist, auf Witterungsumstände flexibel reagieren zu können. Die Erfassung soll pro Raster und Periode (Früh- bzw. Hochwinter) mindestens acht bis zehn Stunden dauern. Diese können über zwei bis drei benachbarte Tage verteilt werden.
Bei der Begehung der Fläche müssen alle größeren Lebensräume wie Wald, Offenland, Gewässer und Siedlungen berücksichtigt werden. Die Ergebnisse lassen sich als „vollständige Beobachtungsliste“ auf ornitho.de speichern oder in Papierform auf entsprechenden Erfassungsbögen eintragen. Wer möchte, kann quantitative oder semi-quantitative Daten wie zum Beispiel die Zählung eher seltener Arten und mittelhäufiger Arten, z.B. die Schwarmgröße bei Finken, ergänzen. Das Vorhaben wird im Winter 2023/24 mit einem „Probelauf“ beginnen und 2024/25 oder 2025/26 offiziell starten.
.
Falls Sie weitere Fragen haben sollten, melden Sie sich bei philipp.herrmann@lbv.de